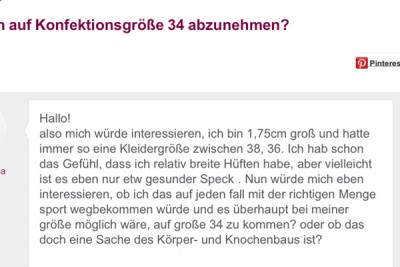Diese Woche brachte eine Premiere im Job. 21 Riesenverträge. Leider nicht in Umsatz, sondern nur in Aufwand und Papier. Ich meldete mich am Dienstag für anderthalb Stunden vom Telefon ab, um die Dinger zu schreiben. Ich habe drei Tage gebraucht, bin aber noch lange nicht fertig, denn nun müssen diese Monster noch in Papier raus, mit Anschreiben versteht sich.
Proudly presented by Deutscher Ämterwahnsinn, denn man glaubt, mit der extremen Kontrolle dieser Vertragsform den Arbeitsmarkt zu regulieren. Statt dessen ist es nur Ärger für alle Beteiligten.
Ansonsten tat ich, was in der letzten Woche wohl alle taten: Ich kramte kopfschüttend die warmen Hoodies aus dem Schrank und ging zur Arbeit. Immer noch besser, als in diesem mistigen Wetter den Jahresurlaub zu absolvieren. Am Freitag trug ich sogar Kniestrümpfe zum Kleid (Feinkniestrümpfe, seit ich das mal bei einer Schauspielerin sah, mache ich das auch) und kapitulierte so nur teilweise, denn zwischen Mai und September trage ich prinzipiell keine Strumpfhosen.
Überhaupt der Freitagabend. Im Freundeskreis, mit sehr gutem Essen und fettem Vollmond über der Kaserne des Wachregimentes. (Wo wir, als sie leer stand, 1990 einen fürchterlich schlechten Studentenfilm auf umatic drehten, in dem der jetzige Chefdramaturg einer großen Filmproduktionsfirma ein ganzkörpergrün angemaltes Alien spielt.)
Dann kamen wir nach Hause und ich las, dass Bert Neumann tot ist. Es ist lange her, dass ich mit ihm zu tun hatte, 25 Jahre, in der Vorbereitung auf Castorfs Volksbühnenzeit. Aber verdammt noch mal, der war drei Jahre älter als ich.
So langsam macht sich in mir die Erkenntnis breit, dass die 50er ein gefährliches Alter sind. Freunde, Weggefährten und Bekannte sitzen plötzlich beim Tod auf der Schippe und haben arg Mühe, heil wieder runterzukommen.
Wobei es sein kann, dass das Leben in den folgenden Jahren nicht ungefährlicher wird und die Zeit, in der wir uns für unsterblich hielten, definitiv vorbei ist.
Auf Twitter gab es dieser Tage eine Diskussion, ob Fotos für den Empfänger einer Bewerbung wichtig sind oder nicht. Das ist in 140 Zeichen schwierig zu diskutieren, aber ich habe einiges dazu zu sagen.
Bewerbungschreiben mit oder ohne Foto?
Eine schriftliche Bewerbung kann sehr viel über eine Person sagen, ohne dass die Entscheider diese je gesehen haben. Aber eigentlich ist sie ein Trick. Sie beinhaltet die Aufgabe, Informationen zu organisieren und sich selbst und sein Können möglichst kommunikativ und technisch korrekt, in die Kultur der Branche und auf die Anforderungen der Stelle passend und nicht zuletzt noch die eigene Person merkfähig darzustellen.
Eine Bewerbung kann keine Passung herstellen, denn entweder es passt oder es passt nicht. Sie ist das erste Level im Bewerbungsprozess, das man absolvieren muss, um ins nächste zu kommen.
Das Ziel einer schriftlichen Bewerbung ist, nicht aussortiert zu werden und die Möglichkeit für ein (Video-)Telefonat, eine Einladung in ein Assessment-Center oder gleich für ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Mehr nicht.
Die purste Form der Bewerbung wird in manchen Orchestern zelebriert. Die Kandidaten spielen hinter einer Wand, damit ausschließlich die musikalische Leistung zählt. Da Orchester verbeamtete Zwangsgemeinschaften von kreativen Individualisten sind, die zudem noch großes Mitbestimmungsrecht haben, ist das sehr nötig, ansonsten würde nichts entschieden werden.
In anderen Ländern ist eine Bewerbung mit Foto (teils auch mit Angaben über Alter, Kinder und Familienstand) nicht erwünscht. In Deutschland gibt es Experimente zu anonymisierten Bewerbungsverfahren, die den Fokus völlig auf Bildungs- und Berufsbiografie und Beurteilungen legen. Mal schauen, ob sich das durchsetzt.
Ich komme aus einer Branche, in dem das Foto – zumindest bei Schauspielern – die Produktverpackung war und einen kleinen Ausblick auf das zu erwartende Potential bot. Was mich verpflichtete, sehr genau hinzusehen und die vielen kleinen Mogeleien und Selbsteinschätzungsmängel zu erkennen*.
Jetzt wiederum arbeite ich für eine Branche, in der Fotos in Bewerbungen total nebensächlich sind, weil die Leute nicht in die Teams integriert werden und zum Teil Schutzkleidung oder genormte Arbeitskleidung tragen, mit der sie sowieso nicht richtig erkennbar sind. Da in dem Pool, auf den ich zugreife ca. 50% Migranten sind, sind auch die Nationalität und die ethnische Erscheinung weitgehend egal.
Das klassische 08/15-Foto in der Bewerbung bringt ohnehin nur die Information: Ok, ich bin über dieses Stöckchen gesprungen, habe mich in Klamotten gezwängt, die ich nur zum Bewerbungsgespräch anziehe und eine blöde Pose eingenommen, die überhaupt nichts über mich aussagt. Mehr als ein Haken an „ok., hat die Nase mitten im Gesicht und zwei Augen“ kommt da selten rüber.
Was bedeutet es, kein Foto in der Bewerbung mitzuschicken? Nun, es ist wie immer, wenn man etwas vermeidet, handelt man sich etwas anderes ein. Die instinktive Entscheidung, ob jemand in die Firma passt oder nicht, ist nur aufgeschoben.
Plötzlich kommt im Vorauswahlprozess der Textinformation viel mehr Bedeutung zu. Das kann gut sein, um zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, wenn diese Informationen ein ausreichendes Potential und gute fachliche Passung auf die Stelle verraten. Muss es aber nicht. Letztlich zählt Leistung im Job nur zum Teil. Der Rest ist Chemie, sowohl mit den Mitmenschen am Arbeitsplatz und als auch den Kunden und die Berufsrolle, die man spielen soll.
Fehlen Foto oder essentielle Angaben, die für manche Personalentscheidungen wichtig sind, haben Personalberater sehr schnell Hilfsmittel parat, anhand derer diese Informationen zwischen den Zeilen oder im Internet herausgefunden werden können. Oder man macht vorab, statt eine teuere Einladung auszusprechen, ein Videointerview. – Was wiederum einen recht guten Blick in die Wohnung erlaubt. Das mag nicht jeder.
Letztlich müsste man so viel weglassen – Geburtsort, Studienorte, Beschäftigungsjahre, Namen -um wirklich keinen Aufschluss über Herkunft, Geschlecht, Intaktheit oder Alter zuzulassen. Dann kann man es auch gleich lassen, weil solche Bewerbungen, außer bei ganz jungen Leuten, keine wären.
Noch bitterer ist es, eine Projektion ausgelöst zu haben. Wir haben alle Stereotypen im Kopf, wie jemand mit einer bestimmten Berufsbiografie sein und aussehen soll. Diese Stereotypen ändern sich sehr langsam und meist erdrutschartig, wenn die Zeit reif ist.
Wer sich ungern mit direkter Ablehnung konfrontiert und dadurch sehr gekränkt und frustriert wird, sollte nicht zu solchen in Deutschland unorthodoxen Mitteln greifen. Das ist etwas für Steher und Kämpfernaturen.
Ich hatte das mal unfreiweillig getestet. Ich hatte als Studentin dem Nachrichtenchef eines Fernsehsenders einen Brief geschrieben, meinen Lebenslauf mitgesendet (ich war mit Bewerbungen immer gern informell) und er rief mich an und lud mich zum Casting ein. Er mochte meinen Brief und er mochte meine sehr gute Telefonstimme.
Als ich dann kam und er mich sah, zuckte er zusammen. Ich war 5 cm größer als er und einen ganzen Tick breiter. Der Rest der Veranstaltung war Spießrutenlaufen. Er gab mich fix an gernervte Studiotechniker ab, die mich kleines, angststarres Greenhorn mit Wonne mit rotem Licht und Teleprompter quälten. Nichts, was ich noch mal haben müsste.
Bei welchen Gelegenheiten ist es möglich, kein Foto mitzusenden? Bei Stellen, die keinen visuellen Publikumskontakt haben, zum Beispiel im Callcenter und abgeschotteten Büros oder bei den Gelegenheiten, bei denen man eine gesuchte und rare Arbeitskraft ist. Bei jeglichen Gelegenheiten, wo die Berufsrolle Äußerlichkeiten nicht braucht, weil man sowieso nicht zu sehen ist oder womöglich eine Unternehmensbotschaft verkörpern muss.
Oder, wenn man sämtlichen Erwartungen an die Berufsrolle und das Äußere eines Bewerbers überhaupt nicht entspricht und trotzdem für die Stelle gut geeignet ist und keine andere Möglichkeit hat, als die direkte, trockene Bewerbung ohne weitere Kontaktmöglichkeit. Damit verschafft man sich die Chance, dass die Aufmerksamkeit am Text bleibt und nicht vom Foto abgelenkt wird. Denn dann hat man nichts zu verlieren, braucht aber ein dickes Fell.
Machen wir uns nichts vor. Jemand, der tiefe Vorurteile zu Hautfarbe, Nationalität, Alter oder Körpernorm pflegt oder Mitarbeiter als Objekt der sexuellen Begierde in Reichweite haben will, ist ohnehin nicht zu überzeugen.
Meist ist es günstiger als die harte Tour, einen anderen Weg zu wählen. Wer anders als erwartet, aber bereits bekannt ist oder Fürsprecher hat, hat mehr Chancen. Schließlich passiert unsere berufliche Entwicklung nicht im luftleeren Raum. Ein bisschen Netzwerk gibt es immer und wer an den richtigen Stellen zupft, wird wohlwollende Aufmerksamkeit und Fürsprache bekommen. Wenn das nicht passiert, schätzt man sich vielleicht falsch ein oder hat andere Defizite, die einen wirklich nicht zum Wunschkandidaten machen.
In meiner Berufspraxis sehe ich eher Menschen Schwierigkeiten haben, die schlecht ausgebildet sind, keinen Bock haben, sich nicht gut organisieren und fokussieren können, sich überschätzen oder sichtliche Defizite im Sozialverhalten haben.
Ansonsten empfehle ich für solche Themen immer das Buch von Malclom Gladwell. Gladwell ist selbst jemand, der der Berufsrolle eines Universitätsprofessors überhaupt nicht entspricht, er weiß also, wovon er redet, wenn er über intuitive Entscheidungen spricht.
*Das hilft einem dann auch sehr beim Onlinedating.